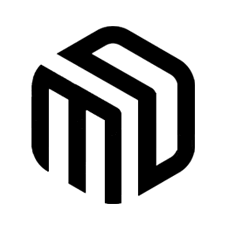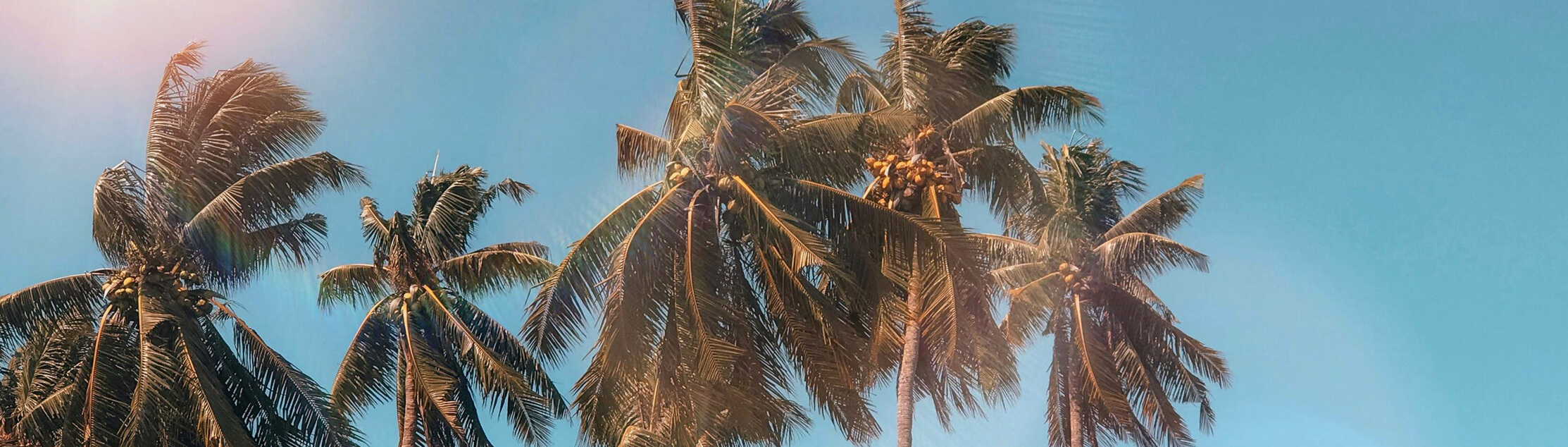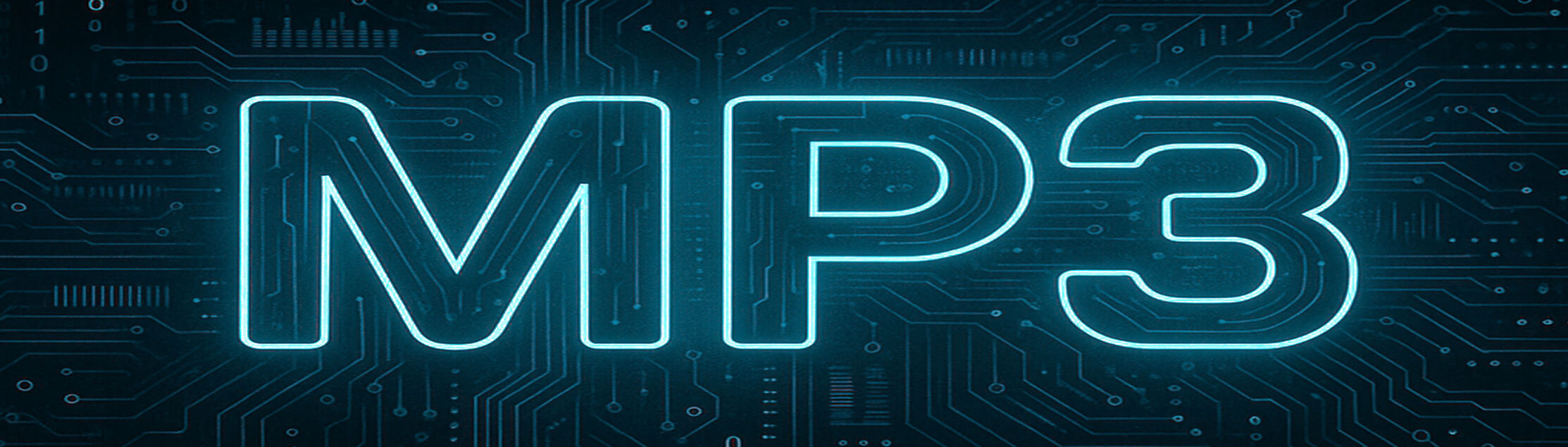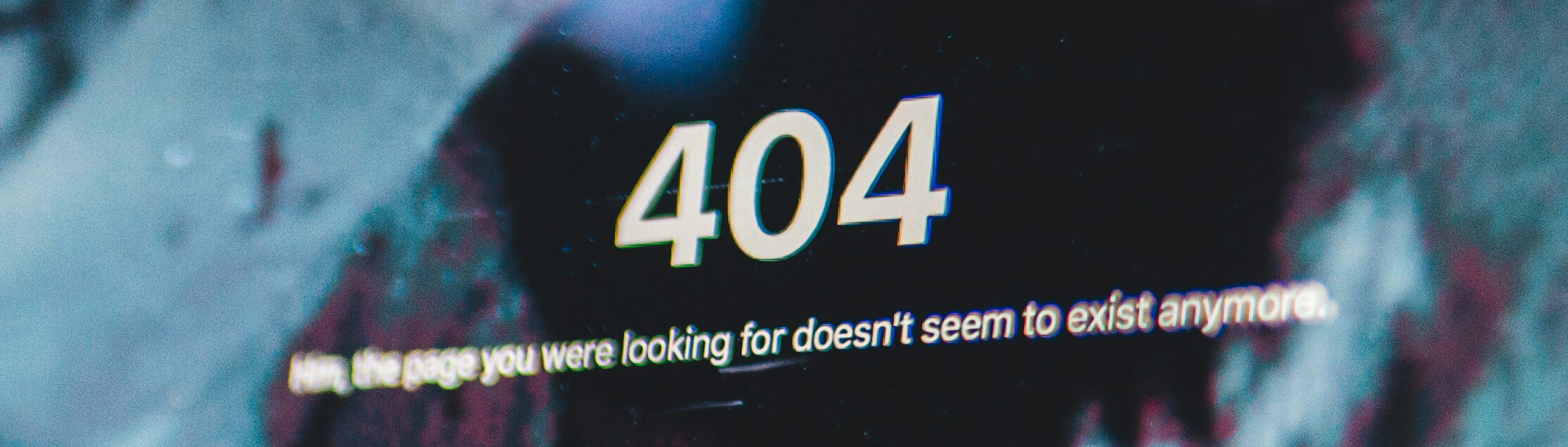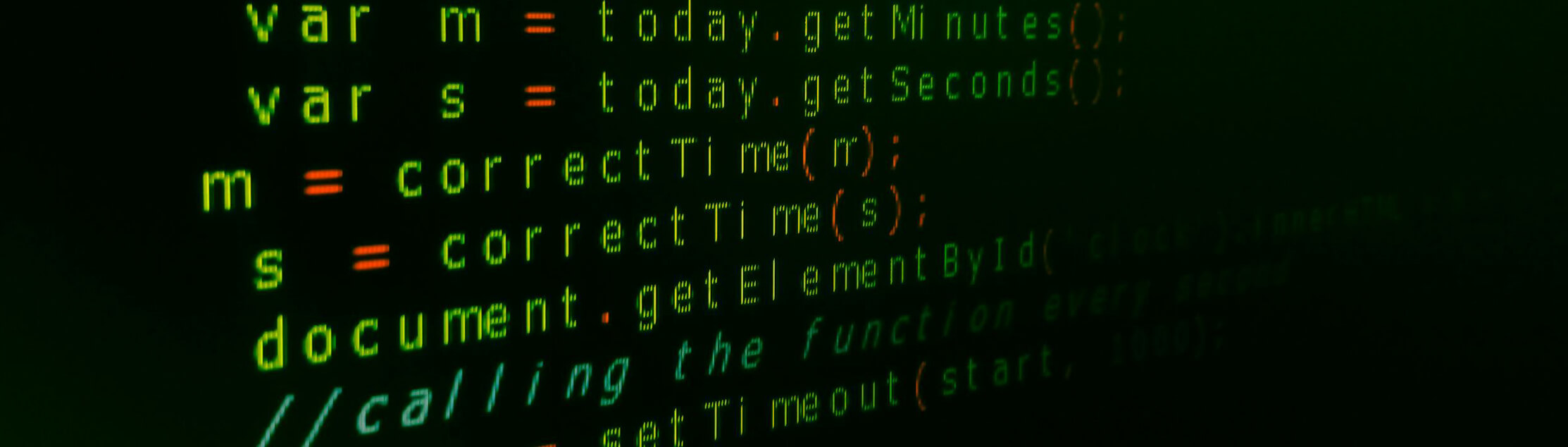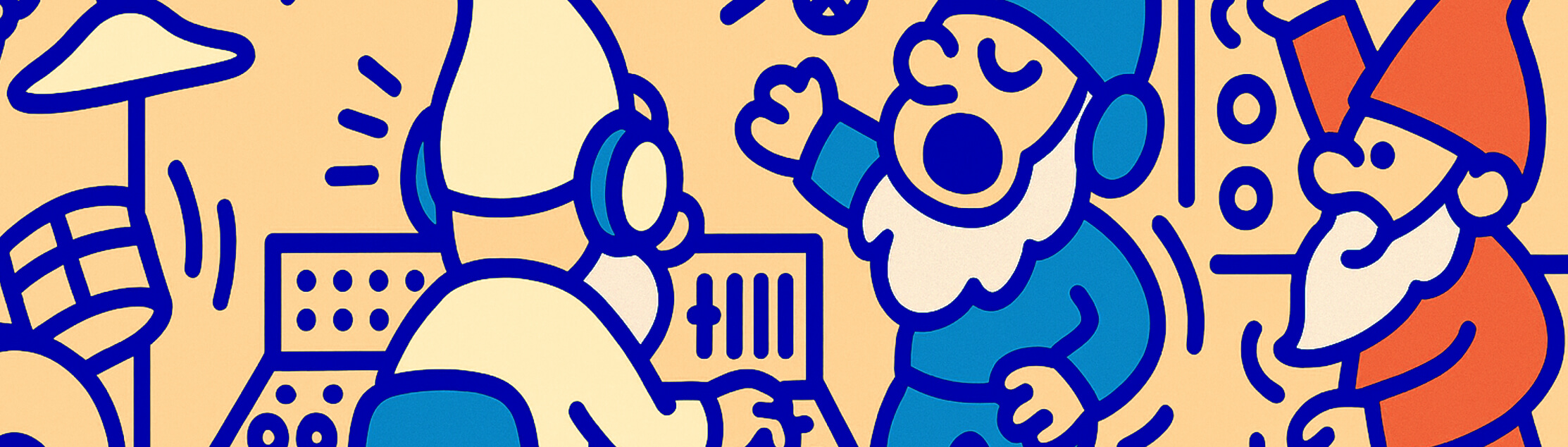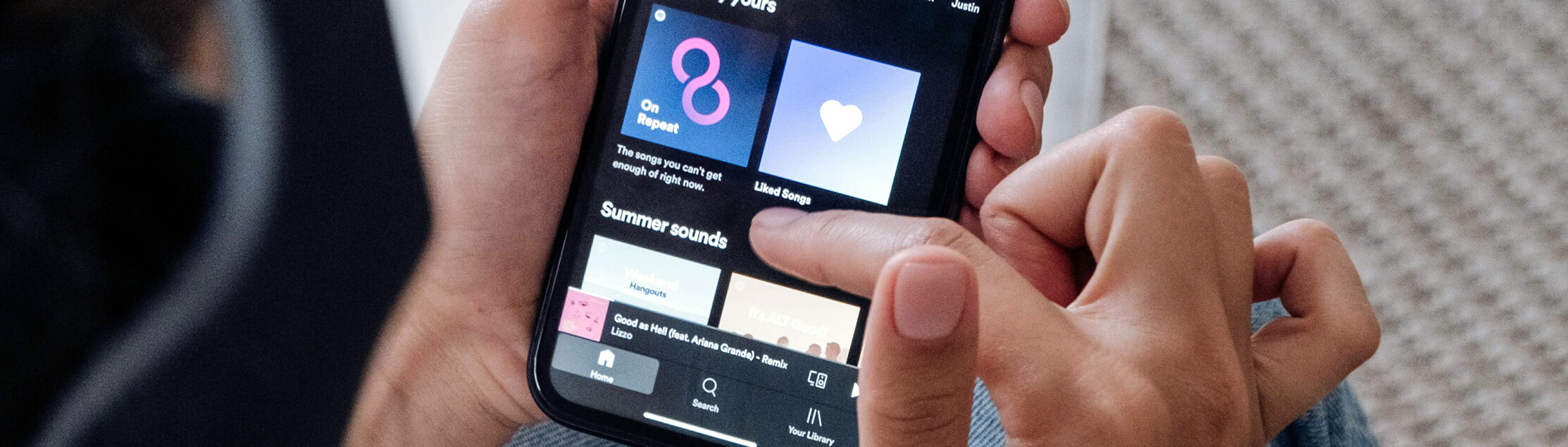
25 Feb. PLAYLIST PITCHING: DAS GEFÄHRLICHE SPIEL MIT DER RELEVANZ
In der heutigen Musikindustrie gibt es kaum einen Bereich, der so heiß diskutiert wird wie das sogenannte “Playlist Pitching”. Musiker, Labels und PR-Agenturen setzen alles daran, ihre Songs in die großen, kuratierten Playlists von Spotify, Apple Music und Co. zu bekommen. Die Hoffnung: Eine Platzierung in einer der begehrtesten Playlists kann den entscheidenden Durchbruch bringen, Millionen von Streams generieren und den Künstler in die Charts katapultieren. Doch ist das Playlist Pitching wirklich der Schlüssel zum Erfolg oder nur ein weiteres Marketing-Tool, das mehr Schein als Sein ist?
Die Illusion des Erfolgs
Zunächst einmal: Die Idee hinter Playlist Pitching ist durchaus nachvollziehbar. Es geht darum, einen Song auf den richtigen Plattformen, bei den richtigen Kuratoren und in den richtigen Playlists zu platzieren. Wer es in die größten und populärsten Playlists schafft, hat die Möglichkeit, von einem breiten Publikum gehört zu werden, ohne auf teure Werbung oder PR-Kampagnen angewiesen zu sein. Doch die Realität sieht oft anders aus. Was als vermeintlicher Erfolg gefeiert wird, entpuppt sich häufig als bloße Illusion.
Denn, wer sich intensiv mit Playlist Pitching beschäftigt, merkt schnell: Es geht nicht nur um den Song. Vielmehr zählen Beziehungen, Netzwerke und oft auch das richtige Timing. Die Chance, in eine der sogenannten “Editorial Playlists” aufgenommen zu werden, ist rar. Viele dieser Playlists werden von einer kleinen Gruppe an Redakteuren kontrolliert, die selbst wiederum in einem ständigen Konkurrenzkampf stehen, um die “nächste große Sache” zu entdecken. Dabei entscheiden nicht nur die musikalischen Qualitäten eines Tracks, sondern auch die Frage, wie sehr dieser Song ins Image der Playlist passt und ob er mit den aktuellen Trends korreliert.
Ein weiteres Problem: Das Playlist Pitching ist von einer tiefen Kommerzialisierung geprägt. Jedes Musikstück wird zunehmend wie ein Produkt behandelt, das in die richtigen Kanäle gedrückt werden muss, um profitabel zu sein. Wer die richtigen Verbindungen hat, kann sich diesen Erfolg mitunter “erkaufen”. Und das führt uns zu einer weiteren ernüchternden Wahrheit: Playlist Pitching hat oftmals weniger mit der Qualität der Musik zu tun, sondern vielmehr mit der Frage, wie gut sich ein Song in die bereits bestehenden, kommerziellen Strukturen einfügt.
Der Einfluss der Streaming-Plattformen
Spotify, Apple Music und Co. haben die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, revolutioniert. Die Zeit der CDs und Alben, in denen sich Künstler über ihre Plattenfirmen und deren Marketingstrategien profilieren konnten, ist weitgehend vorbei. Heute entscheidet der Algorithmus der Streaming-Dienste, wer gehört wird und wer nicht. Playlists sind das neue “Radio”, die neue Möglichkeit, in die breite Masse vorzudringen und das, ohne ein großes Label oder eine teure PR-Kampagne zu benötigen. Wer in einer großen Playlist landet, kann sich über massenhaft neue Hörer und Streams freuen.
Doch dieser Fortschritt hat auch seine Schattenseiten. Die Streaming-Plattformen selbst sind keineswegs die neutralen Vermittler, die sie vorgeben zu sein. Sie betreiben ihre eigenen Playlist-Strategien, die in erster Linie wirtschaftlich motiviert sind. Es geht nicht mehr um die Musikauswahl aus einer rein künstlerischen Perspektive, sondern vielmehr darum, was in den Algorithmen gut funktioniert. Musik, die in den großen Playlists landet, muss “hörbar” und “vermittelbar” sein und das bedeutet häufig: konform, kommerziell, mainstreamig. Wer nicht diesem Schema entspricht, hat kaum eine Chance auf eine Platzierung.
Das gefährliche Spiel mit der Relevanz
Das Playlist Pitching hat die Musiklandschaft zweifellos verändert. Doch statt die Vielfalt der Musik zu fördern, führt es oft zu einer Reduktion der Vielfalt. Playlists spiegeln vor allem das wider, was aktuell als “populär” gilt, was sich mit den gängigen Trends deckt. Der Geschmack der breiten Masse wird zum Maßstab, und wer aus diesem Raster fällt, hat oft das Nachsehen. Das bedeutet, dass innovative oder experimentelle Musik, die nicht dem Mainstream entspricht, kaum eine Chance hat, entdeckt zu werden.
Ein weiterer gefährlicher Aspekt: Die Fokussierung auf Playlists führt dazu, dass viele Künstler ihre Musik ausschließlich auf diese Form des Erfolgs ausrichten. Die Gefahr dabei ist, dass Musik weniger aus kreativen Impulsen heraus entsteht, sondern vielmehr nach den Kriterien von Streaming-Diensten und deren Algorithmen produziert wird. Authentizität und künstlerische Freiheit geraten so immer mehr in den Hintergrund. Die Musik wird zum Produkt, das für den Algorithmus optimiert ist, statt eine emotionale Verbindung zum Hörer aufzubauen.
Die Sucht nach Streams und Zahlen
Ein zentraler Punkt beim Playlist Pitching ist die Jagd nach Streams. Wer in einer großen Playlist landet, hofft, dass dies die Zahl der Streams immens ansteigen lässt. Das Problem dabei: Diese Zahl ist nicht immer ein Indikator für die tatsächliche Qualität eines Songs oder die Tiefe einer Fanbindung. Es ist eine Sucht nach Zahlen, die von den Streaming-Plattformen bewusst geschürt wird, um den Wert eines Songs messbar zu machen. Der Hörer wird so zum Teil einer gigantischen Datenmaschinerie, in der es weniger um das echte Musikerlebnis geht, sondern um die Kontrolle über Zahlen und Statistiken.
Und was passiert, wenn der Song einmal nicht mehr in der Playlist vertreten ist? Der Hype ist oft schnell verflogen. Streams und Reichweite nehmen rapide ab, und der Künstler steht vor der Herausforderung, sich erneut in den Fokus zu rücken, meist durch noch mehr Playlist Pitching und den nächsten Versuch, in eine neue, größere Playlist aufgenommen zu werden.
Warum Playlist Pitching auch Sinn macht und wo die Chancen liegen
Trotz all der Kritik gibt es auch klare Argumente für das Playlist Pitching. Es bietet Künstlern eine Möglichkeit, mit überschaubarem Aufwand eine breite Hörerschaft zu erreichen und in die bekannten Strukturen der Streaming-Dienste vorzudringen. Gerade für unabhängige Musiker, die keinen Vertrag mit einem großen Label haben, ist es eine der wenigen Chancen, die eigenen Werke einem internationalen Publikum bekannt zu machen.
Außerdem kann Playlist Pitching den Künstlern nicht nur mehr Streams, sondern auch wertvolle Kooperationen und Kontakte verschaffen. Wer in einer gut kuratierten Playlist landet, hat möglicherweise Zugang zu neuen Fans, aber auch zu Brancheninsidern, die den nächsten Schritt in der Karriere unterstützen können. Es ist eine Möglichkeit, sichtbarer zu werden, nicht nur in den Charts, sondern auch in den Augen der Branche.
Playlist Pitching – Eine goldene Chance oder ein Trugbild?
Die Frage, ob Playlist Pitching Sinn oder Unsinn ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Es bietet eine echte Chance für Künstler, aber es ist auch ein zweischneidiges Schwert. Wer sich ausschließlich auf Playlists verlässt, läuft Gefahr, in einer Spirale aus Zahlen und Algorithmen gefangen zu werden, in der die Musik selbst zur Ware wird. Wer jedoch das Playlist Pitching als eines von vielen Werkzeugen nutzt und dabei nicht die künstlerische Freiheit verliert, kann durchaus davon profitieren.
Die Realität ist: Musikindustrie heute ist komplexer denn je, und Playlist Pitching ist nur ein Teil des großen Spiels. Um langfristig Erfolg zu haben, braucht es mehr als nur eine Platzierung in einer Playlist, es braucht Authentizität, Kreativität und die Fähigkeit, sich auch jenseits der Streaming-Plattformen Gehör zu verschaffen. In der Welt von Playlists, Streams und Algorithmen bleibt die wichtigste Frage immer noch: Was bleibt vom Künstler, wenn die Zahlen verschwinden?