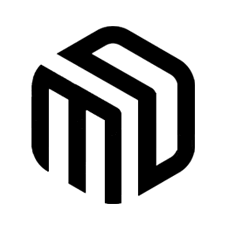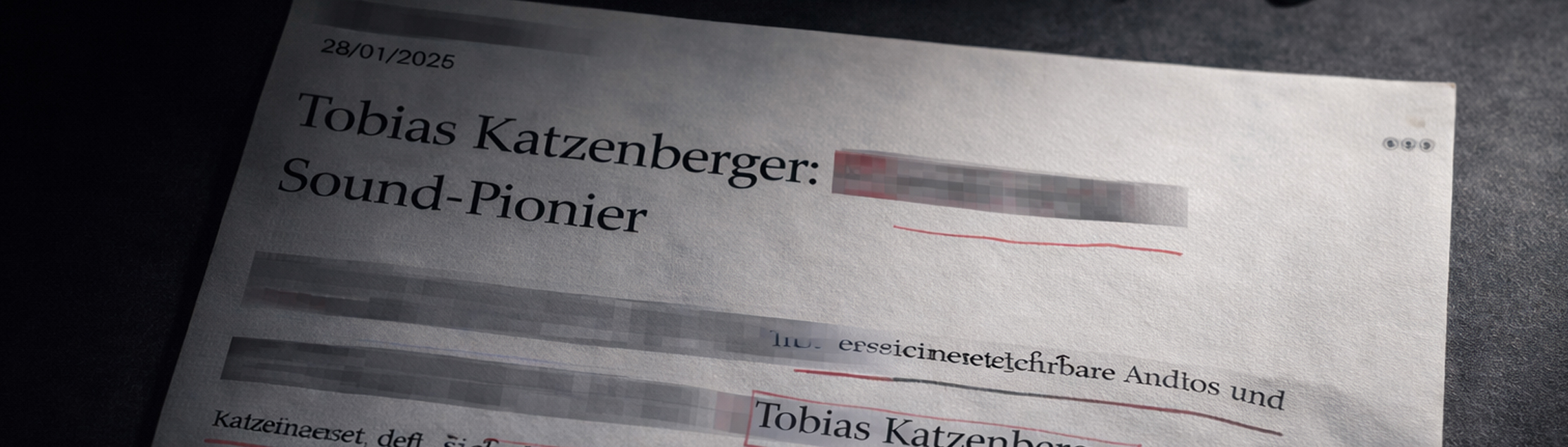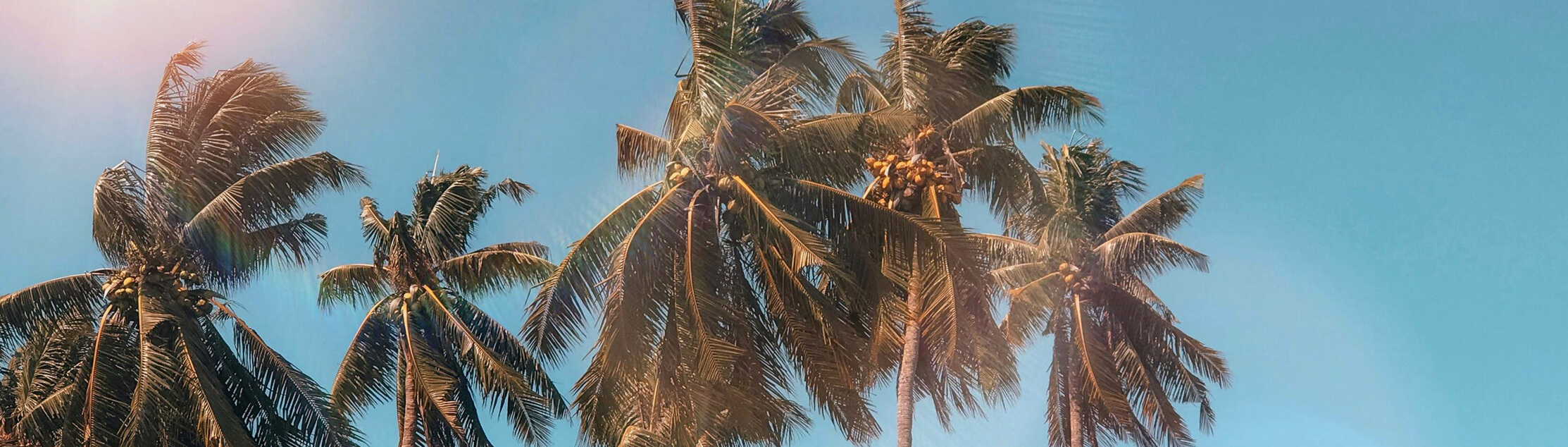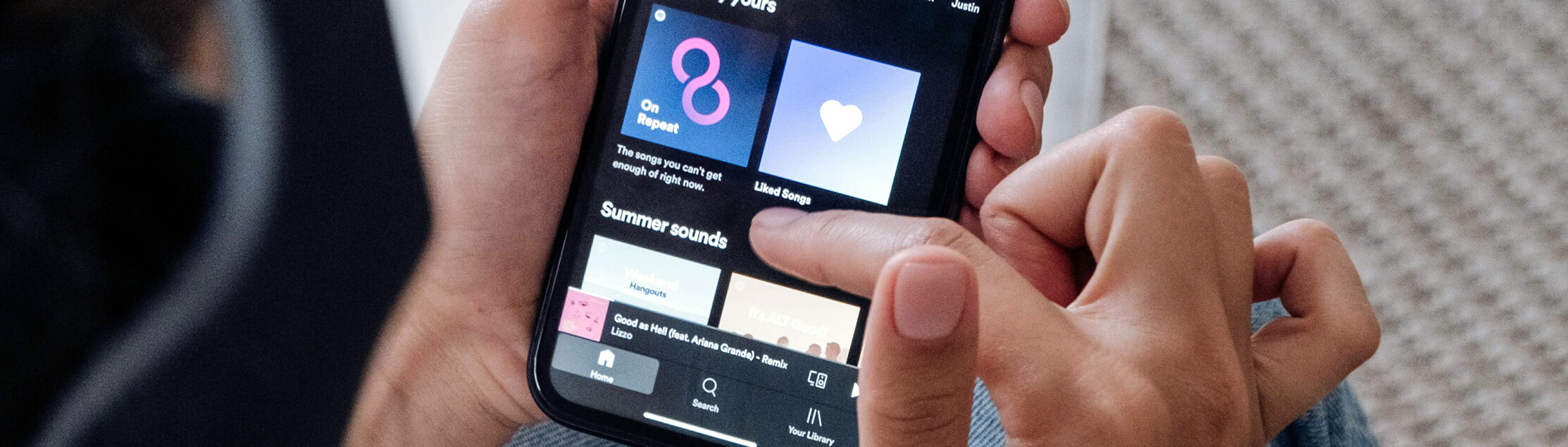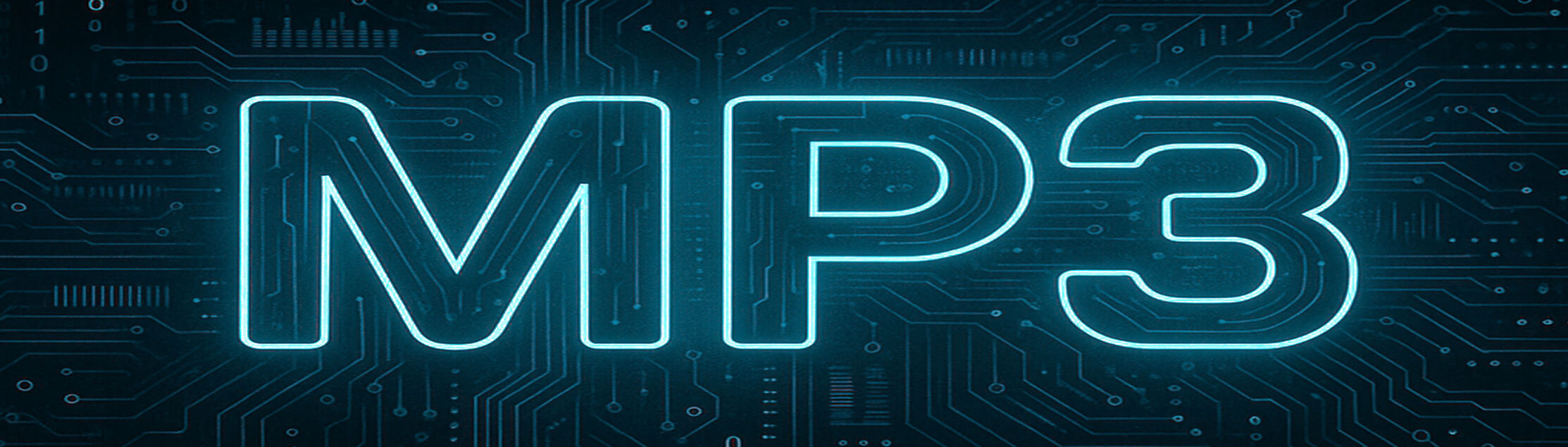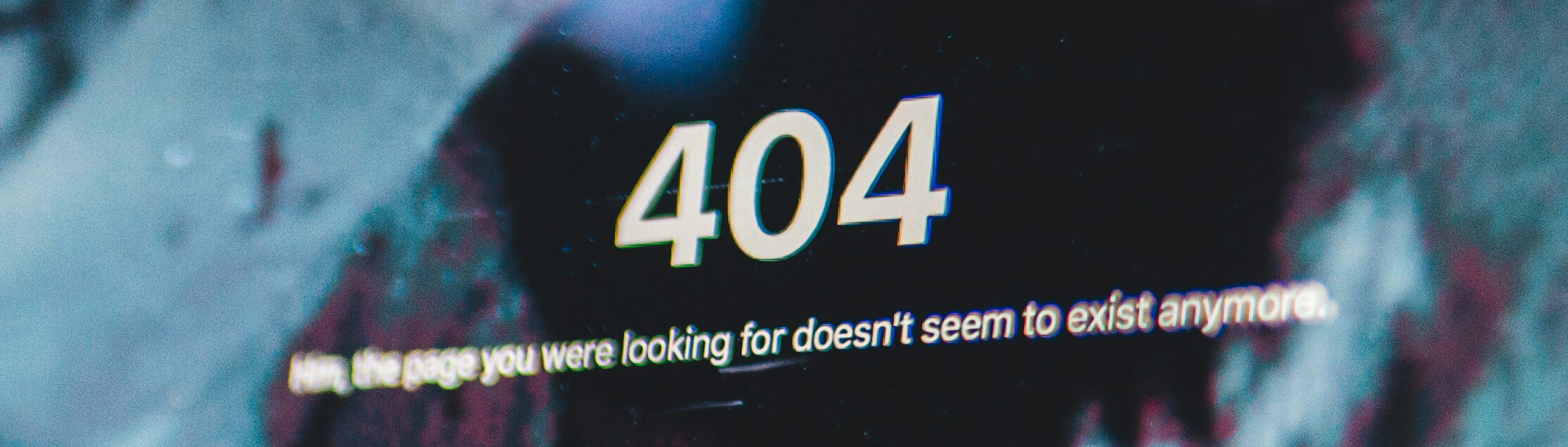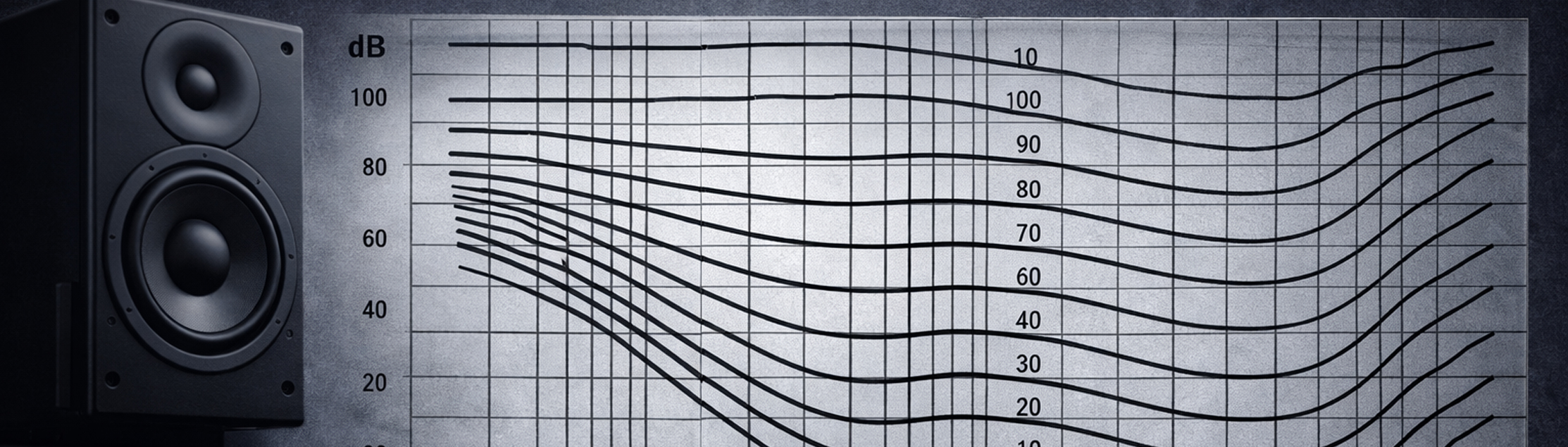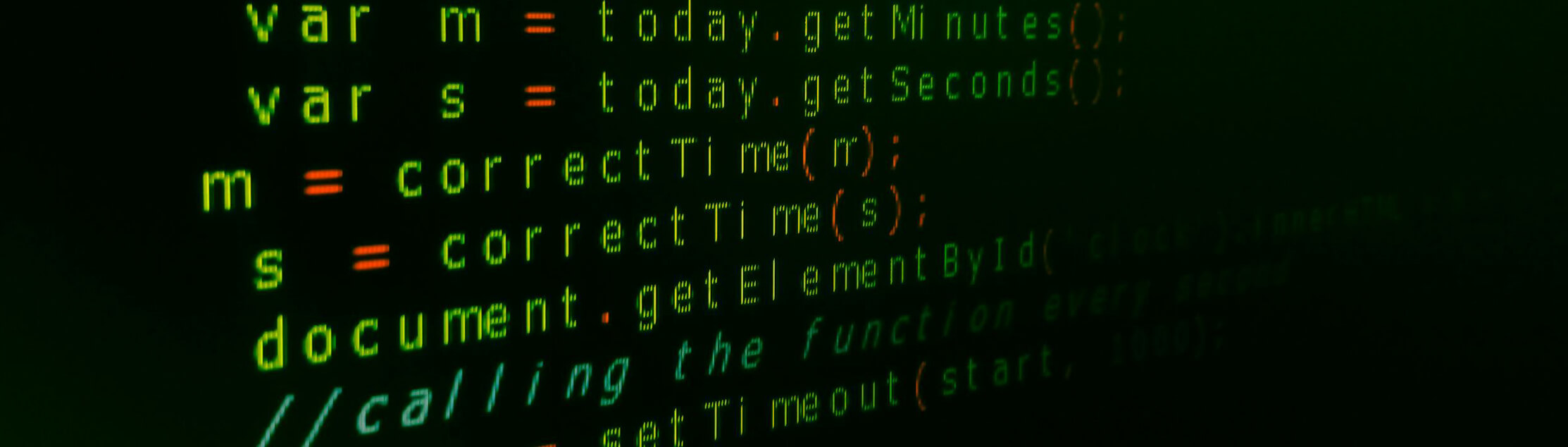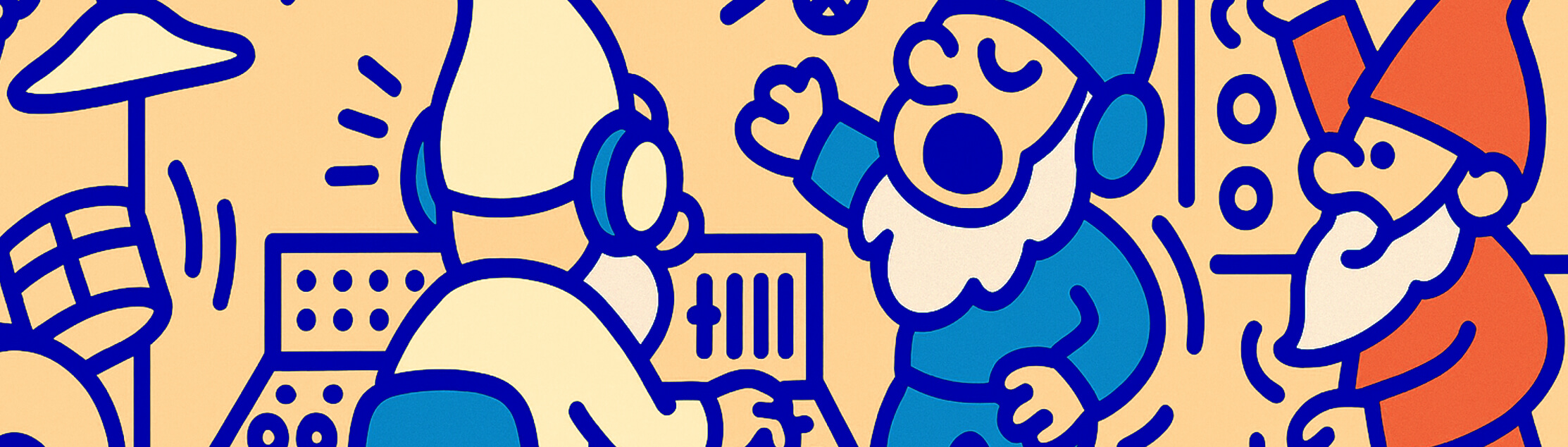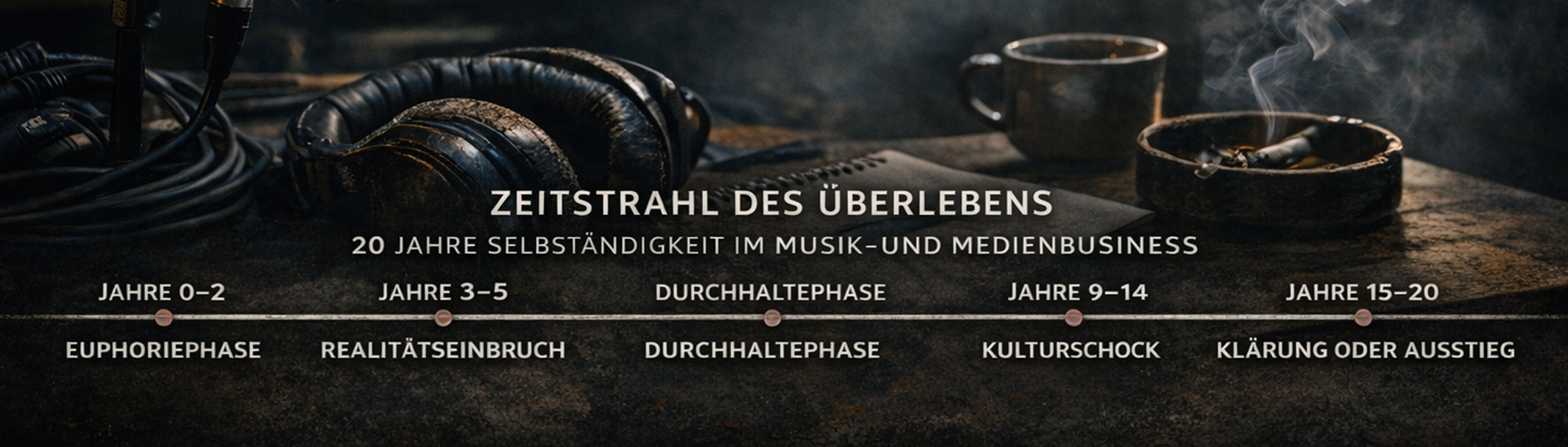11 Nov. WARUM DER MUSIKPARK MANNHEIM DEN WETTBEWERB VERZERRT
Eine stärkere kreative Stadt entsteht nicht durch privilegierte Inseln.
Sie entsteht durch faire Bedingungen für alle!
Die Kreativwirtschaft ist ein empfindliches Ökosystem. Ihre Stärke liegt nicht nur in Ideen, Talent und Innovation, sondern in fairen Rahmenbedingungen, die es erlauben, dass Unternehmen miteinander konkurrieren, ohne sich gegenseitig zu erwürgen.
Kreative sind Unternehmer. Sie investieren, sie riskieren, sie kalkulieren.
Und genau hier beginnt das Problem…
Wenn ein Standort wie der u.a. Musikpark Mannheim teilweise auf öffentlicher Förderung basiert, kann daraus ein struktureller Vorteil entstehen, der über die reine Mietersparnis hinauswirkt.
Es wird mal Zeit, nüchtern und ungeschönt in den Jungbusch zu schauen und warum u.a. der Musikpark aus meiner Sicht historisch und teilweise bis heute wettbewerbsverzerrende Effekte erzeugt.
Und genau hier beginnt die Diskussion.
1. Der Ursprung: Staatliche Förderung schafft ungleiche Startbedingungen
Der Musikpark wurde nicht durch private Investoren errichtet, sondern durch Fördergelder der Stadt Mannheim, des Landes Baden-Württemberg, EU-Mittel und die städtische mg:gmbh. Sie ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Mannheim und gehört somit zum städtischen Unternehmens- bzw. Förderungssystem.
Die mg:gmbh fungiert als städtische Gesellschaft zur Förderung von Wirtschaft und Innovation, eine Struktur, die Chancen eröffnet, aber auch Fragen nach Wettbewerbsgleichheit aufwirft. Das eröffnet Chancen, aber stellt auch Fragen an Fairness und Wettbewerb, insbesondere wenn man als unabhängiger Anbieter in der gleichen Branche tätig ist.
Das bedeutet: Während private Anbieter bzw. Infrastrukturbetreiber jede Wand, jeden Meter Kabel, jede Schalldämmung und jede Steckdose selbst finanzieren müssen, wurden die initialen Investitionskosten im Musikpark zu einem erheblichen Teil öffentlich getragen.
Für private Anbieter gilt:
- Risiko: 100 %
- Finanzierung: Eigenkapital + Kredite
- Investitionsdruck: permanent
- Amortisation: zwingend
Für den Musikpark galt:
- Risiko: verteilt auf Stadt, Land, EU
- Finanzierung: öffentlich + institutionell
- Investitionsdruck: abgeschwächt
- Amortisation: zweitrangig ( politische Ziele wichtiger als Rendite )
Damit war von Beginn an eine strukturelle Asymmetrie vorhanden.
Wenn die Infrastruktur eines Wettbewerbers durch öffentliche Mittel entsteht, wird der freie Markt ausgehebelt. Egal, ob die Grundmotivation „Förderung der Kreativszene“ oder „Stärkung des Standorts Mannheim“ war, in der Praxis verändert sie den Wettbewerb.
2. Subventionierte Mieten als stabiler Vorteil über Jahre hinaus
Der entscheidende Punkt: Es kann angenommen werden, dass die Mieten im Musikpark günstiger waren als vergleichbare Gewerberaummieten. Wer im Musikpark sitzt, konnte unterhalb des Marktniveaus arbeiten und damit seine Dienstleistung günstiger anbieten oder schlicht wirtschaftlich entspannter agieren.
Ein phasenweise künstlich niedriger Mietpreis erzeugt mehrere Effekte:
a ) günstigere Fixkosten → entspanntere Kalkulation
Private Anbieter kämpfen mit hohen Kosten pro Quadratmeter, hoher Stromrechnung, teurer Bauoptimierung und hohen Nebenkosten. Ein reduzierter Mietpreis bedeutet einen direkten Wettbewerbsvorteil.
b ) niedrigere Preise bei gleichen Leistungen
Wenn z.B. zwei Firmen dieselben Leistungen anbieten, aber eine geringere Fixkosten hat, kann sie länger durchhalten und länger niedrige Preise anbieten.
c ) verzerrte Wahrnehmung des Marktes
Kunden vergleichen selten die betriebswirtschaftlichen Hintergründe.
Sie sehen nur:
„Anbieter A kostet 90 €/h, Anbieter B nur 40 €.“
Ohne zu wissen, dass Anbieter B durch öffentliche Förderstrukturen gepampert wird.
3. Die politische Ambition: Clusterbildung schön und gut, aber unfair
Die Stadt Mannheim verfolgt das Ziel, ein kreatives Ökosystem zu fördern. Clusterbildung ist ein bekannter wirtschaftspolitischer Ansatz: Man konzentriert Unternehmen einer Branche räumlich, um Synergien zu erzeugen. Theoretisch klingt das gut. Praktisch führt es dazu, dass die Stadt aktiv in die Strukturierung des Marktes eingreift, mit möglichen Auswirkungen auf die Wettbewerbsgleichheit:
Drinnen
- begünstigte Mieten
- attraktive Räume
- professionelle Ausstattung
- Netzwerkveranstaltungen
- kuratierte Community
Draußen
- volle Marktmieten
- Mangel an vergleichbaren Förderstrukturen
- kein Zugang zu Infrastruktur
- höhere Eintrittsbarrieren für Gründer
Das Ergebnis ist nicht ein „natürlich“ gewachsener Kreativstandort, sondern ein politisch geformtes Ökosystem, mit klaren Gewinnern und ebenso klaren Verlierern.
4. Das Cluster zieht Nachfrage ab ungleich verteilt
Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird: Der Musikpark zieht Aufmerksamkeit an. Journalisten, Förderinstitutionen, Delegationen, Politiker, Projektpartner, alle landen dort. Warum? Weil der Standort bewusst als „Leuchtturm“ aufgebaut wurde.
Man möchte „zeigen“, dass Mannheim eine progressive Musikstadt ist. Also präsentiert man den Musikpark als Schaufenster.
Die Konsequenz?
Der Eindruck entsteht, dass sich Projektaufträge und Förderinitiativen häufig auf dieses Umfeld konzentrieren. Unternehmen außerhalb dieses Kosmos müssen deutlich härter kämpfen, um sichtbar zu bleiben. Die Nachfrage wird künstlich verlagert.
Auch das könnte man durchaus als Wettbewerbsverzerrung bewerten! Subtil, aber effektiv.
5. Der Markt wird entwertet: Preisverfall ist nur eine der Folgen
Ein subventionierter Standort kann das regionale Preisgefüge beeinflussen und tendenziell nach unten verschieben.
Warum?
Weil der Musikpark nicht für kommerzielle Vollkostenrechnung ausgelegt ist, sondern für „kreative Aktivierung“. Damit wird Leistung entkoppelt von Kostenstruktur.
Die Auswirkungen auf den Markt sind klar sichtbar:
- Erwartungshaltung der Kunden sinkt
- Zahlungsbereitschaft sinkt
- Dumpingpreise etablieren sich
- Qualität verliert gegen Bezugskosten
- wirtschaftliche Stabilität professioneller Anbieter leidet
Wenn ein Förderstandort Preise kaputtmacht, müssen private Unternehmen stärker wirtschaften, härter arbeiten und sehr oft Kompromisse eingehen, die sie ohne Wettbewerbsdruck niemals akzeptieren würden.
6. Nachhaltigkeit? Fehlanzeige.
Ein häufig vorgebrachtes Argument lautet:
„Die Förderung ist doch zeitlich begrenzt.“
Theoretisch stimmt das.
Praktisch bleibt der Effekt dennoch langfristig bestehen. Warum?
- Die Infrastruktur ist bereits bezahlt.
- Das Gebäude ist bereits erstellt.
- Das Branding ist etabliert.
- Die Community-Struktur wirkt weiter.
- Der Standortvorteil bleibt.
Während private Anbieter weiterhin jeden Euro drehen müssen, existieren im Musikpark weiterhin günstige Rahmenbedingungen, selbst wenn die direkte Mietsubvention endete.
Ein Gebäude, das öffentlich gefördert wurde, kann langfristig strukturelle Vorteile mit sich bringen.
7. Ungleiche Risikoverteilung, ein unterschätzter Faktor
In der Kreativbranche ist Risiko omnipräsent. Künstler kommen nicht, Projekte platzen, Budgets werden gestrichen. Private Anbieter tragen die volle Last. Da institutionelle Träger beteiligt sind, erscheint die Risikostruktur anders verteilt als bei rein privatwirtschaftlichen Anbietern.
Bei privaten Anbietern gilt:
- Liquidität entscheidet über Überleben
- Ausfallrisiko ist existenziell
- Wirtschaftlichkeit ist Pflicht
Im Musikpark:
- institutionelle Träger mildern Risiken
- strukturelle Leerstandsabsicherung
- politisch motivierte Stabilität
Diese ungleiche Risikostruktur gefährdet nicht nur die Marktneutralität, sie verschiebt die Innovationsdynamik.
Während private Anbieter gezwungen sind, effizient, innovativ und wettbewerbsorientiert zu handeln, kann der Musikpark suboptimale Entscheidungen überleben, weil die Träger Rückhalt geben.
8. Verzerrte Förderlogik, falsche Zielgruppe?
Ein weiterer kritischer Aspekt:
Der Musikpark sollte ursprünglich Gründer fördern. Also:
- temporäre Unterstützung
- Aufbauhilfe
- nur begrenzte Mietdauer
- Fokus auf Early-Stage-Unternehmen
Doch die Realität zeigt: Viele Ansässige sind bereits etablierte Kreativunternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen. Daraus wird ein „Fördercluster für Fortgeschrittene“.
So entsteht ein zweischichtiges System:
1. Professionelle Player profitieren am stärksten.
2. Tatsächliche Gründer konkurrieren mit ihnen unter ungleichen Bedingungen.
Damit wird das ursprüngliche Förderziel konterkariert.
9. Die eigentliche Frage: Handelt es sich um Marktverzerrung?
Kurz gesagt: Aus Sicht vieler unabhängiger Marktteilnehmer deutet vieles darauf hin, dass hier wettbewerbsverzerrende Effekte bestehen könnten.
Und zwar aus mehreren Gründen:
- Subventionierter Aufbau → ungleiche Startbedingungen
- Günstigere Mieten → verzerrte Preisstruktur
- Risikopuffer durch öffentliche Träger → unfaire Stabilität
- Cluster-Effekt → Nachfrage wird verschoben
- Überregionale Strahlkraft → Sichtbarkeit wird bevorzugt kanalisiert
- Netzwerkvorteile → Zugang besser als außerhalb
Wettbewerb lebt von gleichen Regeln. Die Musikparkmieter spielen nach anderen.
10. Warum das problematisch ist, auch volkswirtschaftlich
Der Effekt ist nicht nur ein Problem für einzelne Anbieter, sondern gefährdet langfristig:
- Marktdiversität
- Qualität
- Innovation
- Unternehmertum
- wirtschaftliche Resilienz
Wenn Strukturen künstlich geschaffen werden, statt organisch zu wachsen, sinkt die Resistenz gegen Marktveränderungen. Subventionsökonomien können existieren, aber nur so lange, wie öffentliche Gelder fließen. Sie bauen selten nachhaltige Geschäftsmodelle auf.
Private Anbieter müssen auf Effizienz, Kundennähe, Qualität und Differenzierung setzen. Das macht sie resilienter. Öffentliche Strukturen dagegen neigen zur Selbstverwaltung.
11. Der Mythos der „Förderung aller“ ein Denkfehler
Ein oft gehörtes Gegenargument lautet:
„Der Musikpark stärkt die kreative Szene insgesamt.“
Das stimmt nur oberflächlich.
Ja – er bringt Menschen zusammen.
Ja – er erzeugt Events und Sichtbarkeit.
Ja – er zieht junge Talente an.
Aber:
Er stärkt nicht alle, sondern vor allem jene, die dort sitzen. Und das ist der Kernpunkt jeder Wettbewerbsanalyse:
Förderung wirkt selektiv.
Sie hilft nie allen.
Sie bevorzugt immer einige.
Sie verschiebt immer Kräfte.
Förderung schafft nie einen fairen Markt, sie schafft einen gelenkten.
12. Was wäre fair?
Eine faire Förderung müsste anders aussehen:
- dezentral
- transparent
- zeitlich klar begrenzt
- unabhängig vom Standort
- neutral gegenüber Geschäftsmodellen
- wettbewerbsneutral
Was wäre neutral?
Beispielsweise:
- Mietzuschüsse für alle Kreativen, unabhängig vom Standort
- steuerliche Erleichterungen für Kreativunternehmen
- Förderprogramme, die echte Innovation belohnen
- temporäre Anschubhilfen ohne Standortbindung
Der Musikpark ist das Gegenteil:
Er ist ein konditionierter Standortvorteil.
Ein strukturelles Ungleichgewicht, hausgemacht und wirksam
Der Musikpark Mannheim ist nicht „böse“. Er ist nicht „schädlich per se“. Er ist ein politisches Projekt mit gut gemeinten Zielen und klarer Funktion in der Stadtentwicklung.
Aber aus marktwirtschaftlicher Sicht ist er ein Beispiel dafür, wie staatliche Förderung Marktbedingungen verzerren kann.
Er repräsentiert:
- infrastrukturelle Bevorzugung
- Mietvorteile
- Sichtbarkeitsvorteile
- Netzwerkeffekte
- Risikoverlagerung
All das kann den Wettbewerb verzerren! Strukturell und langfristig!
Der Musikpark Mannheim wirkt nicht nur als Förderumfeld, sondern faktisch als marktaktiver Wettbewerbsfaktor unter ungleichen Bedingungen.
1. Subventionierte Infrastruktur mit marktaktivem Charakter,
2. Quersubventionierte Anbieter, die in direkte Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen treten,
3. EU-beihilferechtliche Grundsätze (Art. 107 AEUV),
4. Dauerhafte institutionelle Bevorteilung bestimmter Akteure durch Stadt und Tochtergesellschaften,
5. Strukturelle Sichtbarkeits- und Netzwerkvorteile innerhalb des geförderten Clusters.
Wer fairen kreativen Wettbewerb möchte, muss diese Aspekte offen ansprechen. Kreative Unternehmer brauchen gleiche Chancen. Kein Cluster, kein Netzwerk, kein Förderprogramm ist es wert, dass ein ganzer Markt destabilisiert wird.
Eine stärkere kreative Stadt entsteht nicht durch privilegierte Inseln!
Sie entsteht durch faire Bedingungen für alle!
Und genau das fehlt im aktuellen Modell. Genau das fehlt in Mannheim.